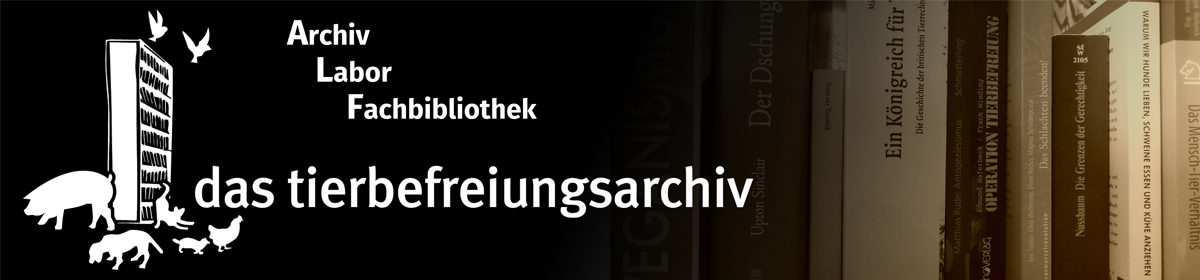Inhalt:
Kurzbiografie
August Kruhl wurde wahrscheinlich 1829 in Parchwitz, Schlesien, in ärmlichen Verhältnissen geboren. A. K. lernte vom 14. bis zum 19. Lebensjahr das Handwerk seines Vaters Gottfried Kruhl und wurde trotz Zweifeln an der Profession zum Weißgerber. Von 1865-1866 arbeitete A. K. in einer Lederfabrik in Berlin und machte dort zusätzlich erste Erfahrungen im Zeitungswesen. Anschließend folgte eine lange Reihe an Ortswechseln unter anderem nach Dortmund, Oberhausen, Köln, Quedlinburg, zu verschiedenen kleinen schlesischen Orten und Halberstadt, wo er nach einer kurzen Flucht über die Schweiz und Belgien inhaftiert wurde für das Herausgeben einer vermeintlich religionsfeindlichen Zeitschrift. A. K. begründete die vielen Arbeitgeberwechsel einerseits mit der Schikane anderer Arbeiter*innen (im Handwerk), andererseits mit finanzieller Erfolglosigkeit (im Zeitungswesen). Zuletzt zog es A. K. im Jahre 1880 nach Hirschberg in Schlesien, wo er als selbstständiger Schriftsteller und Herausgeber seinen Lebensunterhalt bestritt. A. K.s Todesdatum ist nicht bekannt, allerdings wurde er noch 1907 als Herausgeber einer vegetarischen Zeitschrift genannt. A. K. hatte mindestens vier Kinder; aus erster Ehe: Oskar (Oscar) (1858*), Bertha (1859-1860*), Sylvia (1861*-1888†); aus zweiter Ehe: ?.
Engagement in der Vegetarismusbewegung
A. K. war schon früh Anhänger der Vegetarismusbewegung, was aus seinem Besuch des ersten Vereinstages des Vereins für naturgemäße Lebensweise (Vegetarianer) 1869 hervorgeht. Wahrscheinlich durch die frühe Anhängerschaft war er gut in das vegetarische Netz eingebunden, so verschaffte der Dresdner Naturarzt Gustav Wolbold seiner Tochter eine Anstellung. Dennoch scheute A. K. sich nicht, Kritik an der Bewegung zu üben – unter anderem kritisierte er, dass die durch die veg. Ernährung vermeintlich erhöhte Arbeitskraft dazu führe, dass manche Gesinnungsgenossen ihre vegetarischen Untergebenen stark ausbeuteten.
A. K. ordnete sich selbst der tierethischen Strömung der Vegetarismusbewegung zu, wodurch die Spannung zwischen seinen Ansichten und seiner Profession besonders hervortrat. 1871 schaltete A. K. eine Anzeige in dem Vereins-Blatt für Freunde der natürlichen Lebensweise, in der er für seinen Sohn Oscar eine Ausbildung suchte, damit er eine „edlere und sittlichere Beschäftigung“ finde als das Weißgerberhandwerk. In einem Artikel im Jahre 1883 in der gleichen Zeitschrift sprach A. K. von jahrelangen Anfeindungen, die er als vegetarischer Gerber ertragen musste und dass er mit seiner aktuellen Beschäftigung als Schriftsteller nie wieder zurückkehren wollte zum Handwerk. 1885 entbrannte innerhalb der Vegetarismusbewegung eine Debatte um die Zulässigkeit von Reformwollkleidung nach Gustav Jäger. Im Zuge dieses Diskurses, an dem A. K. lebhaft teilnahm, argumentierte er fast ausschließlich mit tierethischer Begründung gegen jegliche tierische Kleidung. Trotz tierethischer Argumentation hielt A. K. an der anthropologischen Differenz fest und ordnete den Menschen klar als höherwertig gegenüber dem Tier ein. Darüber hinaus gab A. K. ab 1886 die vegetarische und anti-vivisektorische Zeitschrift Der Volksarzt für Leib und Seele. Eine Monatsschrift für gesunde Lebensanschauungen in Hirschberg (Schlesien) heraus, die mindestens bis 1899 im 14. Jahrgang existierte, allerdings noch 1907 referenziert wurde. 1890 veröffentlichte A. K. ein Buch, das autobiografische Züge trug und einen Einblick in das Leben von Vegetarier*innen der unteren Schichten geben sollte.
Weitere Ansichten
Wie viele Vegetarier*innen war auch A. K. Anhänger der Reformpädagogik und rühmte sich, nie die Prügelstrafe auf seine Kinder angewandt zu haben. Wahrscheinlich war dies der Einstieg in weitere reformerische Strömungen inklusive des Vegetarismus.
Über die Siegesfeier des Deutsch-Österreichischen Kriegs, die er in Berlin mitbekam, äußerte er sich wenig begeistert und implizierte eine ablehnende Haltung gegenüber dem preußischen nationalistisch aufgeladenen Bellizismus, indem er auf seine pazifistischen Ansichten verwies. Dennoch betrachtete er verallgemeinernd andere Volksgruppen als niederwertig, wie einer Aussage über die indische Kultur und die polnische Wirtschaft zu entnehmen ist. Zuletzt wandte sich A. K. gegen die (revolutionäre) Arbeiter*innenbewegung. Seiner Auffassung nach beuteten sich die Arbeitsgenoss*innen untereinander stärker aus als die großen Kaufmänner und Fabrikbesitzer*innen. A. K. betrachtete die arbeitenden Individuen als „fehlerhaft“ in ihrer Persönlichkeit und antizipierte, dass Erleichterungen für die Arbeiter*innen wie höhere Löhne mit einem Anstieg schädlichen Konsumverhaltens einhergehen und somit verpuffen würden. Trotz A. K.s eigener Zugehörigkeit zur Arbeiter*innenklasse äußerte er sich wiederholt ablehnend gegenüber der Arbeiter*innenbewegung und betonte – wie die bürgerlich geprägte Vegetarismusbewegung insgesamt – die Selbstreform als Lösungsansatz für die soziale Frage.
Werke
- Kruhl, August (1890): Die Wanderungen meiner Tochter Sylvia. Ein einfaches Lebensbild etwas umständlich zusammengestellt und erzählt von August Kruhl, Hirschberg (Schlesien).
Weiterführende Literatur
- Fritzen, Florentine (2006): Gesünder leben – Die Lebensreformbewegung im 20. Jahrhundert. Franz Steiner Verlag.
- Neef, Katharina (2014): Multiple Devianz – Zur Fassbarkeit und Struktur eines alternativkulturellen Phänomens. In: Franke, Edith; Kleine, Christoph; Mürmel, Heinz (Hrsg.): Devianz und Dynamik – Festschrift für Hubert Seiwert zum 65. Geburtstag. Vandenhoeck & Ruprecht: S. 185-203.
- Siemens, Daniel (2009): „Wahre Tugend mit Beefsteaks unvereinbar“ – Diskurse um Ethik und Ästhetik im deutschen Vegetarismus, 1880-1940. In: Elberfeld, Jens; Otto, Marcus (Hrsg.): Das schöne Selbst – Zur Genealogie des modernen Subjekts zwischen Ethik und Ästhetik. transcript Verlag: S. 133-168.
Eintrag von: Simon Kleinert (2022)