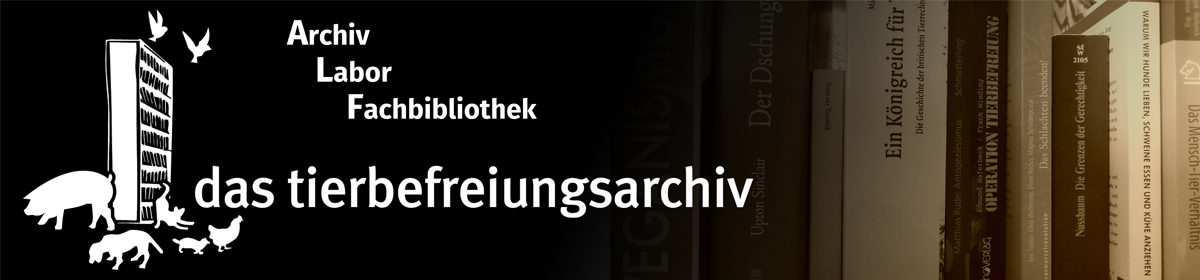Daniel Wawrzyniak:
Tierwohl und Tierethik – Empirische und moralphilosophische Perspektiven
transcript Verlag, Bielefeld, 2019
ISBN: 978-3-83764-560-5
Diese Rezension muss mit meinem Fazit beginnen: Ein überraschend gutes Buch! Das mag im ersten Moment vielleicht seltsam klingen, lässt sich aber schnell erläutern. Beim Begriff „Tierwohl“ denken die meisten vermutlich eher an eine weitere Marketingstrategie zur Legitimierung der Tierindustrie. Beim Lesen des Buchtitels erwartet der eine oder die andere also zunächst, dass aus scheinbar ethischer Perspektive Tierausbeutung dank eines neuen Labels gerechtfertigt werden soll. Diese Bedenken könnten noch verstärkt werden, da die vorliegende Arbeit auch von einem Niedersächsischen Ministerium gefördert wurde. Ausgerechnet Niedersachsen – das Bundesland, das als Zentrum der agrarindustriellen Tierausbeutung in Deutschland gilt. Doch dann werden bereits in der Einleitung die Vorgehensweisen der (empirischen) Tierwohlforschung kritisiert – und ihnen im Buch ernsthafte moralphilosophische Perspektiven entgegengesetzt.
Doch nun von vorn: Das 2019 im transcript Verlag erschienene Buch „Tierwohl und Tierethik – Empirische und moralphilosophische Perspektiven“ von Daniel Wawrzyniak basiert auf dessen Dissertationsschrift aus dem Jahr 2017. Diese wiederum wurde an der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen im Rahmen des Promotionsprogramms „Animal Welfare in Intensive Livestock Production Systems“ – gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur sowie die Georg-Christoph-Lichtenberg-Stiftung – angefertigt.
Formal ist das Buch in drei Teile geteilt, die von einer Einleitung und einem Gesamtfazit mit Ausblick umrahmt werden. Die drei Hauptteile beschäftigen sich mit einem praxisnahen und einem philosophischen Verständnis des Tierwohls sowie einer möglichen Verknüpfung beider Perspektiven im Sinne einer diskutierten Anwendbarkeit des moralphilosophischen Tierwohl-Begriffs auf die Nutztierhaltung. Ansätze und Vorgehensweise werden immer wieder gut erklärt – selbst für Nicht-Philosoph*innen wird das Buch damit verständlich. Der rote Faden bleibt dabei stets erhalten – dank guter Strukturierung, wiederholter Zielbenennungen, mehrfacher Zwischenfazits und hilfreicher Querverweise. Allerdings gerät die Struktur bei genauem Lesen etwas ins Wanken: Das im zweiten Hauptteil versprochene fünfte Kapitel mit einem den Ergebnissen entsprechenden, neudefinierten Tierwohlbegriff fehlt in dem Sinne, zumindest als eigenständiges Kapitel. Die neue, moralphilosophisch hergeleitete Tierwohldefinition lässt sich aber dennoch finden, nur eben 30 Seiten früher als erwartet. Schwerwiegender ist hingegen ein weiteres Manko aus meiner Sicht: Im gesamten Buch wird leider nicht gegendert und es lässt sich auch keine Begründung dessen finden.
Von den formalen Kriterien einmal abgesehen, punktet das Buch – wie eingangs bereits angedeutet – vor allem auf inhaltlicher Ebene: In der Einleitung werden nach kurzer Einführung in die Tierwohl-Debatte zunächst die drei Hauptteile, ihre Fragestellungen, Ziele und Vorgehensweisen erläutert. Hier wird bereits klargestellt, dass „ein adäquates Verständnis von Inhalt und Bedeutung des Tierwohls eine Fortführung der Nutztierhaltung insgesamt als moralisch illegitim herausstellt“ (S. 14). So weit, so gut. Gerechtfertigt wird diese Aussage dann im Rahmen der eigentlichen Arbeit (siehe unten). Das heißt aber nicht, dass es sich hierbei „nur“ um eine weitere Kritik unseres Umgangs mit Tieren* handelt. Vielmehr versucht der Autor, „eine Brücke zwischen der empirischen Tierwohlforschung und der philosophischen Kritik zu schlagen, indem das […] Schlagwort des Tierwohls aufgegriffen und in seiner Bedeutung für tierethische Diskurse beleuchtet wird“ (S. 19). Im ersten Hauptteil werden deshalb auch drei (eigentlich vier) prominente Beispiele der empirischen Tierwohlforschung – das Brambell-Komitee, das Farm Animal Welfare Council/ Committee und die Universities Federation for Animal Welfare sowie kurz das Welfare Quality Project – vorgestellt und kritisch beleuchtet. Insbesondere die Kritikpunkte werden anschließend gut zusammengefasst: Das Tierwohlverständnis in der empirischen Tierwohlforschung wird als reduktionistisch, inkohärent, pragmatisch auf Umsetzbarkeit fokussiert, menschenzentriert, grundsätzlich tötungsbejahend und die Tierausbeutung als alternativlos verstehend entlarvt, um nur einige Kritikpunkte zu nennen.
Daran anschließend gibt es im zweiten Hauptteil verschiedene moralphilosophische Annäherungsversuche an ein deutlich umfangreicheres Tierwohlverständnis, die in einem neuen Wohlansatz münden: Tierwohl ist demnach dann gegeben, wenn ein Individuum „mit seinen objektiven Lebensumständen in autonomer Weise für sich zufriedenstellend zurecht kommen kann“. Dies sei aber nicht der Fall, wenn „das Individuum Lebensumstände akzeptiert oder anstrebt, die es in seiner Möglichkeit einschränken, sozial zu interagieren, sich frei zu betätigen, sich wohl zu fühlen, sich am Leben sowie körperlich und psychisch vital zu erhalten“ (S. 190). Spätestens anhand dieser Definition sollte sich die zuvor zitierte Aussage aus der Einleitung zur Unvereinbarkeit von Tierwohl und Tiernutzung von selbst erklären. Falls nicht, gibt es immer noch den dritten Hauptteil, der den entwickelten Tierwohlbegriff auf die Nutztierhaltung anzuwenden versucht. Doch auch hier wird schnell klar, dass beispielsweise allein die Tötung der Tiere* in der Nutztierhaltung nicht mit dem anspruchsvollen Tierwohl in Einklang zu bringen ist. Gleichzeitig werden auch die Grenzen des Tierwohlkonzepts anhand einiger Beispiele bzw. Sonderfälle diskutiert. Nichtsdestotrotz bleibt das Fazit, dass sowohl ein anspruchsvolleres Tierwohlverständnis als auch das Überdenken des eigenen moralischen Selbstverständnisses vonnöten sind – denn das in Tierindustrie und Tierwohlforschung verbreitete Tierwohlverständnis und (tier-)ethische Überlegungen sind nicht in Einklang zu bringen: „Die Hoffnung der Fürsprecher der Nutztierhaltung, selbige durch innovative Reformen mit rundum ‚gutem Gewissen‘ fortführen zu können, erweist sich dabei als fehlgeleitet“ (S. 224). Denn: „Solange Tiere einem Nutzenkalkül unterzogen bleiben, wird ihr Wohl immer beeinträchtigt werden“ (S. 296). Dabei geht es hier nicht nur um die Verursachung von (Tier-)Leid, sondern auch um die Beeinträchtigung positiver Erfahrungen der Tiere* – das könnte auch für Tierbewegte eine neue Perspektive sein.
Um nun auf mein eigenes, anfangs bereits angedeutetes Fazit zurückzukommen: Überraschend positiv war nicht nur die klare Positionierung zur Unvereinbarkeit von Tierindustrie und Tierethik, sondern auch die – wenngleich kurze – Einführung in alternative Konzepte, wie Tierwürde und Tierrechte. Abschließend sind zudem noch die „Überlegungen für die Zukunft der Tierwohlwissenschaft“ als positiv hervorzuheben, da sie die aus der Arbeit abgeleitete Forderung eines Ausstiegs aus der „Nutztierhaltung“ aus der philosophischen Debatte zurück in die Praxis holt. So werden hier am Ende des Gesamtfazits noch Schritte für eine gesellschaftliche Transformation benannt, deren Ziel die Abschaffung der Tierausbeutung ist – Schritte, die nicht nur von den Protagonist*innen der Tierindustrie und der Tierwohlforschung, sondern auch von Tierrechts- (und Tierbefreiungs-)aktivist*innen, Politiker*innen und der Gesellschaft als solche schon jetzt und in Zukunft umgesetzt werden sollten. Sogar der in der Tierbefreiungsbewegung oft thematisierte Widerspruch zum Tierschutz wird dabei indirekt angesprochen: „Keine besseren Haltungsbedingungen für sie einzufordern, hieße das Wohl jetziger Tiere, zugunsten einer schnelleren Befreiung zukünftiger Tiere vom Nutzenkalkül, komplett zu opfern“ (S. 380). Damit liefert das Buch vermutlich auch für viele Aktivist*innen neue Denk- und Diskussionsansätze. Ich kann es deshalb sehr empfehlen…